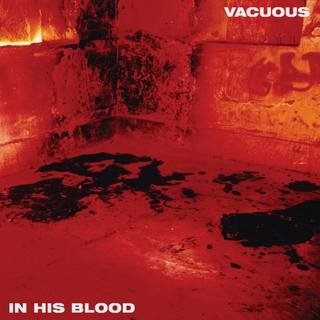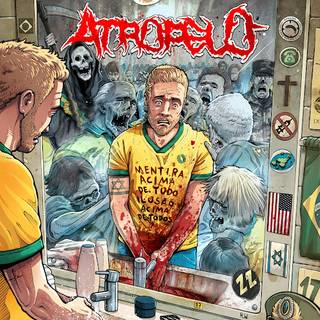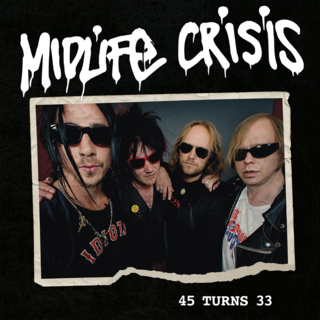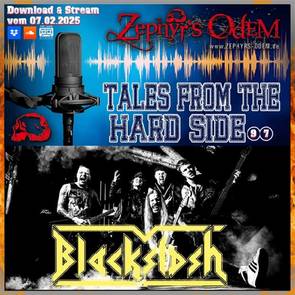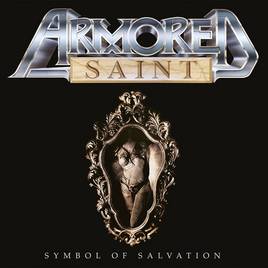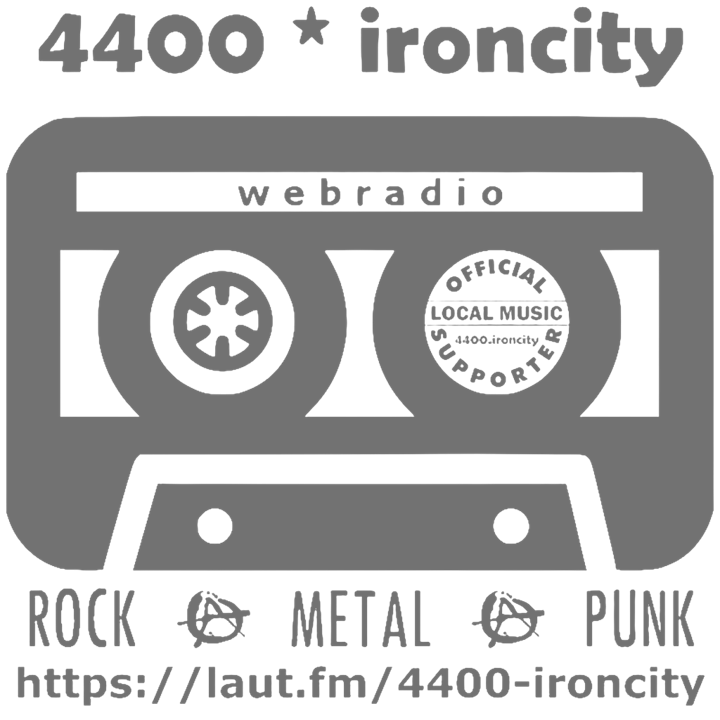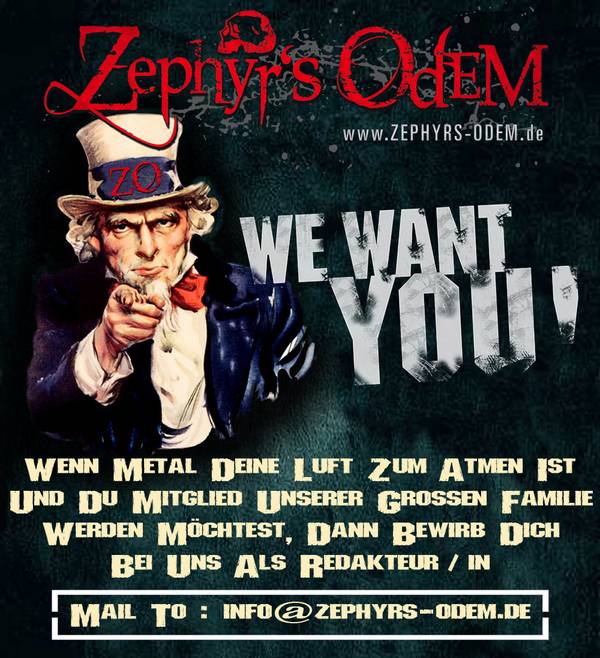Live on Stage Report: Party San 2024
vom 08. bis 10.08.2024 - Schlotheim @ Flugplatz

TAG 2 – Freitag, 09.08.2024
Sonnenbrand, leicht einen sitzen und keine Termine. Wie herrlich. Also erstmal nach Schlotheim gehopst, um unter anderem dem lieben Kaffeemenschen, der im Übrigen einmal mehr für den besten Koffeinschub des Party San verantwortlich war, seine drei Beutel Eis zurückzubringen, die er uns geliehen hatte, weil irgendwer sein warmes Bier auf das kalte gestellt hat. Ich schaue hier mal keinen böse an, gell Sören?
Danach noch schön chillen, die Muskeln lockern, ein paar Dehnübungen, denn gleich sollten Stillbirth traditionell mit Grind den zweiten Festivaltag eröffnen. Vorab musste ich mich allerdings gleich mit Merch der Kaputtniks eindecken, die mit Abstand die geilsten Motive des Wochenendes am Start hatten. Alles in allem begann der Freitag also mehr als nur zufriedenstellend.Im Laufe des Nachmittags wurden dann aber die Eskalationsstufen gezündet und Sören ließ sich zusammen mit Corrosive Basser Sascha temporäre Partnertattoos machen. Ich glaube, da war Alkohol im Spiel [Olaf]

Traditionsgetreu gehört der Freitags-Opener-Slot auf dem PSOA immer einem Party-Abrisskommando. Dieses Jahr bekleidet von STILLBIRTH – einer aufstrebenden Kapelle aus Süddeutschland, welche sich gerade mit DISENTOMBED auf Tour befinden, die hier später auch noch Erwähnung finden werden. Die Vorabrecherche zeigte: Die Jungs speilen in eigenen Badeshorts, die man auch käuflich erwerben kann und vor der Bühne passiert allerhand Schabernack und bezeichnen ihren Stil als „Brutal Surf Death Metal“, sodass keine Millisekunde an den Gedanken vom Kater des Vortags verschwendet wurde und mein Bruder und ich uns pünktlich um 12 vor der Mainstage einfanden. Bier schmeckte auch schon wieder – konnte also losgehen.
Wer bis dato noch nicht wach war, war es spätestens nach den ersten Riffs die so messerscharf und druckvoll aus der Anlage kamen, dass selbst die Schaumkrone in meinem Bier anfing zu bangen. Alter Verwalter – was ne Show. Standesgemäß gab es einen dauerhaften Circle Pit, den die Jungs auch noch mit Aufblas-Bongs und Bällen versorgten. Während Pikachu mit Stahlhelm, die Seifebnlasenmaschinen-Fee und das Einhorn friedlich ihre Runden drehten, stand ich kurz hinterm Pit mit einem fetten Grinsen. Das war echt der geilste Freitags-Opener ever. Party ohne Ende, aber eben auch musikalisch hohe Handwerkskunst! Highlight: die Wall of Death über die ganze Breite bis zum FOH. [Steppo]


Der bergische Löwe hatte zu Beginn des Gigs echte Probleme beim Brüllen. Der Sound war dermaßen dünn, dass ich mich kurz fragte, ob ich versehentlich bei einem Soundcheck gelandet bin. Es dauerte ein paar Songs, bis der Mix besser wurde, und der gewohnt kraftvolle Klang der Bergischen Krieger endlich durchdrang. Aber bis dahin... nun ja, es war eher ein Fauchen als ein Brüllen.
Natürlich ist es auch extrem undankbar, direkt nach Stillbirth auf die Bühne zu müssen, denn die gelben Hupfdohlen haben das Publikum vorher ordentlich durch den Fleischwolf gedreht, und so war vor der Bühne bei Obscurity deutlich weniger los. Die Leute waren scheinbar entweder erschöpft oder an der Bierbude hängen geblieben. Doch das schien die Band wenig zu stören.
Obscurity, gewohnt professionell und mit viel Leidenschaft, zog ihren Gig durch wie eine gut geölte Kriegsmaschinerie. Frontmann Agalaz fauchte sich durch das Set, und spätestens ab der Mitte des Auftritts war der Sound wieder so druckvoll, wie man es von den Bergischen erwartet. Der Löwe brüllte nun mit der vollen Wucht, die man sich von einer Band ihres Kalibers erhofft.
Trotz des etwas holprigen Starts und der leichten Flaute im Publikum lieferte Obscurity eine solide Show ab. Der Spirit und die Hingabe der Band waren ungebrochen, und wer noch genug Energie hatte, wurde mit einem kraftvollen Viking-Metal-Spektakel belohnt. Auch wenn es diesmal nicht der triumphale Auftritt war, den man vielleicht erwartet hatte – der Löwe hat sich am Ende doch noch behauptet. [Olaf]


Dummerweise lief ich früh auf dem fast leeren Infield unserem Chef Olaf in die Arme, was zur Folge hatte, dass ich mir erstmal ein ausgiebiges Bier- und Ginfrühstück in die Rüstung knistern musste. Gut, dann hat man eben um 10 Uhr schon wieder die Lampe an. Egal…..Musik. Ich liebe ENTHRONED und gerade die Frühwerke der Band, als noch ein gewisser Lord Sabathan ins Mikro keifte, zählen mit zum Besten, was der Mittneunziger Black Metal hervorgebracht hat. Im Vorfeld fragte ich mich allerdings, ob eine derartige Show auf der Hauptbühne um 14:05 Uhr funktionieren wird. Standesgemäß kam es wie es kommen musste! Gefühlte 40 Grad im Schatten und gleisendes Sonnenlicht, welches den vor kurzem noch eiskalten Cuba Libre binnen Sekunden in eine Art Grog verwandelte, sorgten nicht unbedingt für die beste Black Metal Stimmung.
Erfreulicherweise zeigte das auf die Performance der Belgier mit ihrem mittlerweile in Norwegen lebenden Sänger Nornagest keinerlei Auswirkungen und so verfärbte sich der Himmel über Schlotheim zumindest gedanklich pechschwarz. Irre präzise, pfeilschnell und mit einer derart düsteren Brutalität pflügten ENTHRONED durch ein Set voller Hymnen und hinterließen nur noch verbrannte Erde! Highlight waren für mich das grandiose „Rites Of The Northern Fullmoon” vom 1994er Demo, welches sogar dem Ex-Sänger gewidmet wurde und die alles vernichtende Abrissbirne „Hosanna Satana“ vom letzten Album! Der Sound war kräftig druckvoll, die Band bei bester Laune und recht agil unterwegs, während Feuersalven die blasphemische Show perfekt untermalten. Unbeirrt der frühen Tageszeit und des nicht enden wollenden und unbarmherzig knallenden Sonnescheins, war das eine mehr als beeindruckende Vorstellung! Vielen Dank für diesen tiefschwarzen Abriss! [Patrick]
Am zweiten Tag ging es für mich deutlich früher ins Infield und nach Obscurity und Enthroned wartete mit dem Auftritt von Afsky schon meine dritte Show des Tages. Die Band um Mastermind Ole Pedersen ist längst kein Geheimtipp mehr und so füllte es sich vor der Mainstage schon sehr gut beziehungsweise verblieben die Enthroned -Jünger zum Teil gleich an Ort und Stelle. Denn auch die Dänen lieferten hochwertigen Black Metal zu früher Stunde – und verdunkelten den hellen Tag gleich noch einmal. Wo ihre belgischen Vorgänger noch etwas ruppiger zu Werke gingen, hielt nun etwas Melancholie Einzug. Afsky überzeugten mich erneut mit dem Verschmelzen von harschem Schwarzmetall und eindringlichen, aufwühlenden Melodien und unterstrichen damit den positiven Eindruck der letzten Begegnung mit ihnen.
Nun ging es flotten Schrittes zum Zelt, denn dieses wurde heute durch Cloak erstmals entweiht. Die US Amerikaner starteten schwungvoll und rasant mit „Ethereal Fire“ in ihr Set, bevor durch „With Fury and Allegiance“ die für die Band typisch rockige Note mehr zum Vorschein kam. Mit „Shadowlands“ und „The Holy Dark“ blieb man dem Black’n’Roll treu, was der Combo aus Atlanta wirklich gut zu Gesicht steht. Mit nur vier Songs war der Auftritt zwar leider etwas kurz, aber ebenso auch kurzweilig und machte durchaus Lust auf mehr. [Schaacki]
16:15 Uhr. Zeit für schwedischen Black/Death. Zeit für SACRAMENTUM. Musikalisch auf ihren drei Alben immer Top unterwegs, aber leider liefen die Jungs immer etwas unter dem Radar und stehen seit jeher im Schatten der großen Melodic Black/Death Bands aus Schweden zu denen sie, zumindest in meinem musikalischen Kosmos definitiv dazugehören! SACRAMENTUMs Debütalbum „Far Away From The Sun“ aus dem Jahre 1996 zählt in meinem Kosmos der dunklen Musik zu einem unsterblichen Klassiker des schwedisch, melodischen Schwarzmetalls. Gut so, denn genau dieses Album liegt bei den aktuellen Gigs der Jungs klar im Fokus. Mit etwas bangem Gefühl, ob der im Allgemeinen etwas überzogen theatralischen Darbietung des Sängers Nisse Karlén, suchte ich trotzdem den Weg vom Cuba Libre-Stand in die ersten Reihen vor der Hauptbühne. Nach dem wabernden Intro fegte das aufbrechende Inferno sofort mit „Fog´s Kiss“ über den heiligen Acker. Das folgende „Far Away From The Sun“ stellte aufgrund der erbarmungslos vorherrschenden Hitze eine gewagte These auf, erwies sich musikalisch aber als grandiose Darbietung.
Der obligatorische blutgefüllte Kelch, welchen sich der Frontmann erfahrungsgemäß immer über den Kadaver kleistert, kam standesgemäß beim passenden Bandgassenhauer „Blood Shall Be Spilled“ zum Einsatz. Im Gegensatz zu meinem ersten Live-Kontakt mit SACRAMENTUM auf dem „Braincrusher Festival“ vor knapp zwei Jahren, war die theatralische Grundhaltung des Sängers zwar vorhanden und immer auch ein kleines bisschen drüber, aber bei weitem nicht so grenzwertig übertrieben und so spielte die Band einen rundum gelungenen Gig, bei dem vor allem die neu angestellte Bassistin auch was für Auge bot. Später traf ich Nisse Karlén noch vor der Bühne und neben dem obligatorischen Foto-Fanboy-Moment drängte sich mir die Frage nach dem angekündigten neuen Album auf, worauf mir versichert wurde, dass dieses niemals das Licht der Welt erblicken würde, wenn die Band davon nicht 100% überzeugt wäre! Es wird ein typisches SACRAMENTUM Album werden! Dann lassen wir das mal so stehen und harren der Dinge, die da kommen werden. Mein schwarzmetallisches Herz war jedenfalls schwer entzückt. [Patrick]
Da Vorga direkt im Anschluss das Zelt mit ihrem Set beschallen sollten, blieb ich gleich dort. Da ihre beiden bisherigen Veröffentlichungen bei unseren Redakteuren gut ankamen, wollte ich mich vom Schaffen und auch der Live-Darbietung der Karlsruher überzeugen. Ihr Sound war dunkel und bedrückend wie die Tiefe des Alls selbst, welches im Fokus der Lyrics der Band steht. Mit ihrem spacig angehauchtem Klang, der Thematik selbst und den unkonventionellen Corpsepaints konnten sie gut punkten – auch wenn mich bei Band Nummer fünf ohne große Pause etwas die Kräfte verließen.

Nach einer kleinen H2O-Druckbetankung und einer Portion extra salziger Pommes ging es wieder bergauf. Ein Glück, bereiteten sich Los Males Del Mundo doch gerade auf ihre Show vor. Zu den beiden aus Argentinien stammenden Bandgründern gesellten sich an Bass und Schlagzeug Nikita Kamprad und Tobias Schuler von Der Weg Einer Freiheit, während Stefan Dietz, der am Tag zuvor noch mit seiner Band Horresque hier spielte, an der zweiten Gitarre aushalf. Ihr Set startete mit „Falling Into Nothing“ und auch wenn dieser Titel so wie der Bandname nun nicht gerade für große Lebensfreude stehen, so zeigte sich die Truppe doch sehr lustvoll und vor allem Sänger Dany Tee gab von der ersten bis zur letzten Silbe alles.
Es folgten noch „The Silent Agony“, „Nothing but a Lie“ und „Eternal Circle of Vain Efforts“, herzliche Danksagungen ans Publikum und eine Umarmung mit dem sympathischen Frontmann, bevor ich das Zelt erst einmal in Richtung Zephyr’s Odem Treffen verließ. [Schaacki]


Bewitched auf dem Party San 2024 – ein Gig, der die Unterwelt zum Brodeln brachte, aber dennoch nicht ganz in den finsteren Olymp aufstieg. Die Schweden haben ja bekanntlich diesen gewissen Retro-Charme, der sich aus den Tiefen des Black/Thrash Metals der 80er Jahre speist. Live sorgt das grundsätzlich für Stimmung, auch wenn es hier und da einige Stolpersteine gab.
Das Set war natürlich gut gespickt mit Klassikern wie "Hellcult Attack" und "At the Gates of Hell", die mit ihren rohen Riffs und dem knallharten Tempo ordentlich ins Mark gingen. Doch wie manche Online-Reviews anmerken, bleibt die Performance – so mächtig sie auch klingt – manchmal etwas steif, als ob die Band die Apokalypse predigen würde, aber selbst nicht so ganz davon überzeugt wäre. Eine gewisse Monotonie schlich sich ein, die aber von den treuen Fans bereitwillig ignoriert wurde.
Musikalisch war alles da, was man erwartet: peitschende Gitarren, donnernde Drums und ein Sänger, der mit seinem heiseren Gekreische die Seele der Hölle beschwor. Doch da war dieses Gefühl, dass eine Band wie Bewitched live mehr Feuer versprühen könnte, wenn sie sich nicht so sehr auf ihre Vintage-Sound-Signatur verlassen würden. Die Bühnenshow? Eher minimalistisch. Manchmal wünschte man sich fast ein wenig Pyrotechnik oder wenigstens einen Opferaltar für die passende Optik. Da war irgendwie beim Chronical Moshers mehr Feuer unterm Arsch.'
Nichtsdestotrotz bleibt zu sagen: Bewitched lieferten solide ab. Kein überirdischer Gig, aber für Fans der alten Schule des extremen Metals definitiv ein Genuss. Ein bisschen mehr Flexibilität und Spielfreude auf der Bühne hätten die Sache jedoch perfekt gemacht. Aber wer braucht schon Perfektion, wenn man von höllischen Hymnen zerschmettert wird?


Kraanium– eine Abrissbirne in musikalischer Form, bei der jeder Nackenmuskel ordentlich was zu tun bekam. Die ursprünglich mal aus Norwegen stammende internationale Truppe ist bekannt für ihren kompromisslosen Slam Brutal Death Metal, und live wurde das gnadenlos umgesetzt. Man kann sagen, dass sie keine Gefangenen machen und lieber direkt in die Vollen gehen – wie eine Horde Wikinger, die nur darauf wartet, den nächsten Schädel zu spalten.
Was sofort auffiel, war die rohe Energie, die von der Bühne kam. Ja, Kraanium sind nicht gerade für filigrane Nuancen bekannt, aber was sie an Raffinesse vermissen lassen, machen sie durch schiere Brutalität wett. Der Sound war so schwer, dass man ihn beinahe körperlich spüren konnte. Besonders die tiefen, gutturalen Vocals und die gnadenlosen Breakdowns rissen das Publikum aus jeder möglichen Komfortzone und mir den White Russian aus der Hand.
Kraanium sind live manchmal etwas eintönig– und ja, das stimmt schon, wenn man auf technische Finesse hofft. Aber mal ehrlich: Wer zu einem Kraanium-Gig geht, erwartet keine Jazz-Improvisationen, sondern pures musikalisches Gemetzel. Das Set war von vorne bis hinten eine Schlammschlacht an Brutalität, und das Publikum liebte jede Sekunde davon. Wer nach dem Konzert noch aufrecht stehen konnte, hat eindeutig was falsch gemacht.


NervoChaos ist bekannt für ihren kompromisslosen Death Metal, der live wie ein tropischer Sturm über einen hinwegfegt. Und genau das lieferten sie auch hier ab: Heiß, aggressiv und absolut unbarmherzig.
Die Setlist war eine geballte Ladung Wut, die das Publikum ordentlich ins Schwitzen brachte. Schon der Opener setzte den Ton für die restlichen 45 Minuten: kein Schnickschnack, keine Atempause, einfach draufhauen. Was NervoChaos allerdings auszeichnet, ist die gekonnte Mischung aus klassischem Death Metal und einem Hauch von südamerikanischem Wahnsinn – das merkt man auch live, wo sie zwar den Boden unter den Füßen der Zuschauer erzittern lassen, aber dabei dennoch einen Hauch Exotik verbreiten.
Der Sound war dreckig, die Riffs direkt aus der Hölle, und die Drums? Eine Dauerfeuerattacke auf die Sinne. Man könnte fast meinen, dass hier nicht nur die Musik, sondern auch das Equipment unter der Hitze Brasiliens gelitten hat.
Humorvoll betrachtet, könnte man sagen, dass NervoChaos wie ein heißes brasilianisches Gericht daherkommt: nichts für zarte Mägen und definitiv nur etwas für die, die mit viel Schärfe klarkommen. Aber das Publikum war voll dabei, schüttelte die Haare und moschte, als gäbe es kein Morgen. Insgesamt: Ein wildes, chaotisches und durchweg unterhaltsames Konzert, das zeigt, dass NervoChaos live zu ihren Namen stehen – nervenaufreibend, aber in der besten Art und Weise!
Seit über drei Jahrzehnten schleudern Incantation ihre finstere Gedankenströme in die Welt, und live merkt man ihnen das Alter zu keinem Zeitpunkt an. Ob da der Leibhaftige die Finger im Spiel hat?
Der Auftritt war schwer, dunkel und gnadenlos – wie ein unaufhaltsamer Marsch ins Verderben. Schon mit den ersten Tönen zog sich eine düstere Atmosphäre über das Gelände, und es wurde schnell klar: Incantation sind nicht hier, um zu unterhalten, sondern um das Publikum in die tiefsten Abgründe zu ziehen. Die Riffs? So schwer wie ein Sargnagel, der sich in die Seele bohrt, während die unheimlichen Growls von John McEntee wie Beschwörungen klangen, die längst Vergessenes heraufbeschwören.
Incantation sind ein Bollwerk, eine unerschütterliche Bastion des Old-School-Death-Metal, ohne Schnickschnack, ohne irgendwelche modernisierenden Elemente. Das Tempo variierte von blitzschnellen Attacken bis hin zu doomigen, fast schon quälend langsamen Passagen, die dem Set eine bedrohliche Tiefe verliehen.
Man könnte fast sagen, dass Incantation weniger ein Konzert als vielmehr ein Ritual zelebrierten. Witzig dabei: Während andere Bands versuchen, ihre Fans mit Interaktion bei Laune zu halten, wirkt es bei Incantation fast so, als hätten sie das Publikum vergessen – es ging nur um die Musik, um das pure, rohe Erlebnis. Am Ende blieb ein überwältigendes Gefühl der Dunkelheit, das einen fast schon melancholisch stimmte. Ein triumphaler Auftritt für die ewigen Diener der Finsternis, und wer dabei war, wird sicherlich noch lange die klammen Schatten spüren, die Incantation hinterlassen haben. [Olaf]


Auf den Auftritt von VARATHRON habe ich mich tierisch gefreut, denn allzu häufig sieht man die Hellenen nicht wirklich auf den Bühnen dieser Welt. Seit mittlerweile 36 Jahren im Geschäft, bilden die Jungs zusammen mit den Landsmännern von ROTTING CHRIST die Speerspitze des schwarzen Stahlexports made in Griechenland. Immer qualitativ hochwertig unterwegs und jenseits der frühen Klassiker drehen gerade die letzten beiden Meisterwerke „Patriarchs Of Evil“ und „The Crimson Temple“ sehr häufig auf meinem Plattenteller. Aufgrund einer kurzen, aber relativ heftigen Regenattacke, stürmte gefühlt das gesamte, Infield pünktlich zum Intro von VARATHRON ins Zelt, welches demnach zum Bersten gefüllt war.
Gut für VARATHRON die kurz darauf mit „Hegemony Of Chaos“ in ihr Set einstiegen und mit sofortiger Wirkung für ein unfassbar breites Grinsen auf den Backen des Schreiberlings sorgten. Beim folgende „Tenebrous“ stellten sich die Nackenhaare auf und Gänsehaut jagte über meinen alkoholgeschwängerten Leib. Wahnsinn…….diese seltsamen, fast einzigartigen und dabei stets ultragenialen Melodielinien vermögen irgendwie nur griechische Black Metal Bands zu erzeugen! Trotz des Regens und er damit einhergehenden Abkühlung, herrschte im Zelt eine gefühlte Luftfeuchtigkeit von 1000% und Temperaturen jenseits des inneren Höllenkreises. Entschädigung für diese selbstauferlegte Geißelung gab es dann zum Schlussakt noch mit „Son Of The Moon (Act II)” vom 1993er Götteralbum „His Majesty At The Swamp” und so wurde ich klitschnass geschwitzt, fix und fertig, aber glücklich und rundum zufrieden in die aufziehende Nacht entlassen. VARATHRON waren definitiv mein Highlight des diesjährigen Party Sans. Vielen Dank dafür an die Bookingfront! [Patrick]
Ich blicke da wirklich nicht mehr durch, welche Batushka da nun auf der Bühne stehen und welche nicht. Ich weiß allerdings, dass ich die Truppe dieses Jahr auf der 70.000 Tons of Hell ein wenig stiefmütterlich behandelt hatte, was ich hier und heute beim besten Willen nicht nachvollziehen konnte.
Ein Konzert, das sich eher wie eine düstere Messe, denn ein typischer Metal-Gig anfühlte. Schon beim Betreten der Bühne war klar: Hier wird nicht einfach Musik gespielt, hier wird ein sakrales Ritual vollzogen. Mit ihren orthodoxen Gewändern und der Ikonenkulisse erweckte Batushka den Eindruck, als hätten sie eine ganze Kathedrale auf das Festivalgelände transportiert. Wer dachte, er könne sich bei einem Death-Metal-Gig einfach treiben lassen, wurde schnell eines Besseren belehrt.
Die Performance war erwartungsgemäß voller Theatralik und Dunkelheit. Der schwere, fast schon feierliche Black Metal wurde untermalt von klagenden, tiefen Gesängen, die das Publikum in eine andere Welt versetzten. Einige behaupten, dass die Show mehr Fassade als Substanz sei – und ja, wenn man auf der Suche nach ständiger Action und Interaktion mit dem Publikum war, wurde man hier wohl nicht fündig. Aber genau das ist der Punkt: Batushka haben nicht das Ziel, das Publikum zum Headbangen zu animieren. Sie wollen die Zuschauer in einen hypnotischen, fast liturgischen Bann ziehen.
Musikalisch war alles, wie man es von der Truppe erwartet: dichte, unheilvolle Klangwände, schwere Gitarrenriffs, die sich wie Nebelschwaden über das Gelände legten, und die eindringlichen Chöre, die das ganze Spektakel untermalten. Doch auch wenn die Stimmung majestätisch war, könnte man mit einem Augenzwinkern sagen: Manchmal fühlte sich das Ganze an wie eine schwarze Messe, bei der das Weihrauchfass mehr Gewicht hatte als die Saiteninstrumente.
Trotzdem: Ein beeindruckender Auftritt, der in seiner Einzigartigkeit schwer zu überbieten war. Batushka haben wieder einmal bewiesen, dass sie Meister darin sind, nicht nur Musik zu spielen, sondern eine finstere, fast mystische Atmosphäre zu schaffen. Wer hier nach einer klassischen Metal-Show gesucht hat, war fehl am Platz – aber wer sich auf das düstere Ritual eingelassen hat, ging mit einem Gefühl nach Hause, als hätte er gerade einen Blick ins Jenseits erhascht. [Olaf]

Man möchte meinen niemand spaltet die Szene in Deutschland gerade so sehr wie Noise – seines Zeichens Drahtzieher bei KANONENFIEBER und NON EST DEUS. Dennoch: Der Erfolg gibt ihm Recht. Auch wenn man um den Vergleich zu BEHEMOTH nicht herumkommt, bedienen doch beide Bands das Thema Religion und Kirche, wird hier doch eher ein eigener Ansatz in der stilistischen Umsetzung gefahren. Und man kann ihm und seinen Kollegen auf der Bühne nur abermals attestieren: das grenzt an Perfektion. Die Songs machen Laune, der Sound war sehr gut und das Zelt prall gefüllt, jeder einzelne Musiker liefert ab und Noise performt mit einer Inbrunst, dass man sich einfach mitreißen lassen muss. Runde Sache! [Steppo]

Mein lieber Herr Gesangsverein, was war das bitte für ein Auftritt? Mit gerade mal sechs Songs in der Setlist haben die Isländer einmal mehr bewiesen, dass weniger manchmal wirklich mehr ist. Dass sie mit nur 6 Songs von fünf verschiedenen Alben eine solche emotionale Bandbreite hinlegen, war fast schon frech – und grandios zugleich.
Es gabe sogar mit „I Myself the Visionary Head“ einem schwarzmetallischen Klassiker von „Masterpiece of Bitterness“. Dieser Song fühlt sich immer noch an, als würde man kopfüber in einen eisigen Fjord stürzen – roh, episch und durchdringend. Mit „Ljós i stormi“ und dem absoluten Gänsehaut-Garant „Fjara“ von „Svarir Sandar“ spielten sie zwei echte Highlights, die das Publikum förmlich auf einer Welle aus Melancholie und nordischer Schönheit mitrissen. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, so gebannt waren die Zuhörer bei diesen monumentalen Stücken.
Dann brachten sie uns sogar einen Vorgeschmack auf das kommende Album mit dem Track „Him Helga Kvöl“ – und was soll man sagen? Der Song fügte sich nahtlos in die Reihe ihrer bisherigen Meisterwerke ein. Sólstafir haben ein Talent dafür, selbst neue Songs sofort wie unsterbliche Klassiker klingen zu lassen. Die Melodien, die Atmosphäre, die Emotionalität – diese Band ist wirklich nicht von dieser Welt.
Leck mich am Arsch, was war das für ein Abriss! Sören konnte mit seiner Kritik an den Isländern meckern, wie er wollte – das war der beste Gig des Wochenendes, da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Art, wie Sólstafir ihre musikalischen Welten aufbauen und uns auf eine Reise durch Sturm und Sehnsucht mitnehmen, hat das Publikum komplett gefangen genommen. Kein anderer Auftritt hat mich so berührt und mitgerissen. Könne die eigentlich auch schlecht? [Olaf]

Auf Anraten von Freunden begab ich mich nach den Isländern noch einmal kurz ins Zelt, um einen Einblick von den mir unbekannten Konvent zu erhaschen. Keine schlechte Idee, denn, auch wenn ich nur einen Teil des Auftritts mitnahm, hinterließ der Doom Death der fünf Damen aus Dänemark einen guten Eindruck.



Doch dann hieß es für mich einen guten Platz vor der Mainstage zu ergattern, denn keine geringeren als meine ewigen Favoriten Behemoth sollten den Freitagabend headlinen. Nie enttäuschten sie mich bisher auf ihren Konzerten, von denen ich bereits zahlreiche erleben durfte, und auch an diesem Abend sollte der Siegeszug nicht enden. Denn während man je nach Geschmack vielleicht über die musikalische Entwicklung diskutieren kann, so doch wohl kaum über die Live-Qualität der Polen – wobei angemerkt werden muss, dass Inferno aus gesundheitlichen Gründen von Jon Rice vertreten werden musste. Doch hielt das Nergal nicht davon ab, die um ihn gescharrten Mitstreiter durch ein wieder einmal saustarkes Set zu führen.

Nach dem Intro „Post‐God Nirvana“ wurde dieses vom noch recht jungen „Once Upon a Pale Horse“ begonnen, führte über „Ora Pro Nobis Lucifer“ zum Klassiker „Conquer All“ und dem von reichlich Pyros begleiteten „Ov Fire and the Void“. Die Zeitreise ging gar bis zum allerersten jemals für Behemoth geschriebenen Track „Cursed Angel of Doom“ zurück.
Mit „Christians to the Lions“ und „Demigod“ folgten weitere Klassiker, bevor mit „The Deathless Sun“ wieder jüngeres Material präsentiert wurde. Nach „Blow Your Trumpets Gabriel“ und „Bartzabel“ kam es zum unverzichtbaren „Chant for Eschaton“ bevor (erwartungsgemäß) die mächtige Hymne „O Father O Satan O Sun!“ den krönenden Abschluss bildete. Sie waren, sind und bleiben einfach eine der beste Live Bands und waren in allen Belangen ein mehr als würdiger Headliner. [Schaacki]